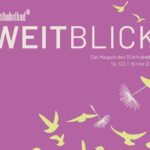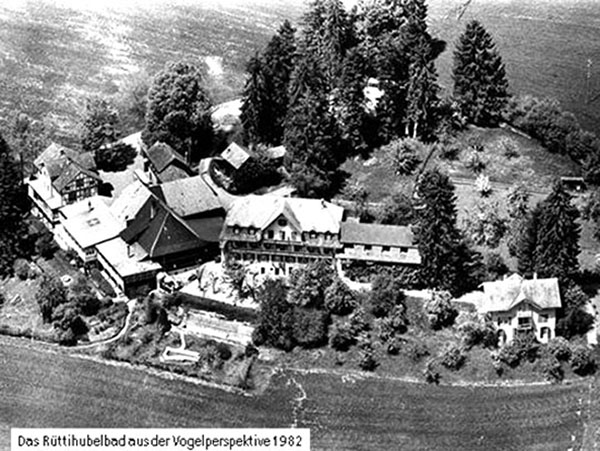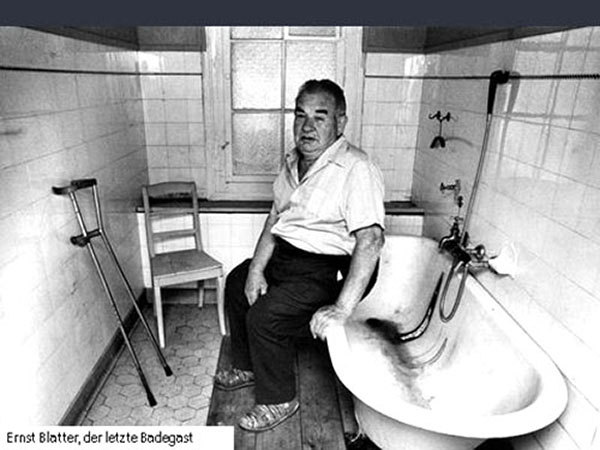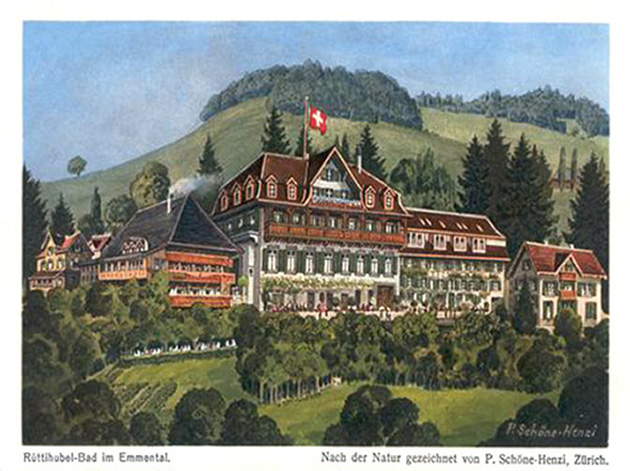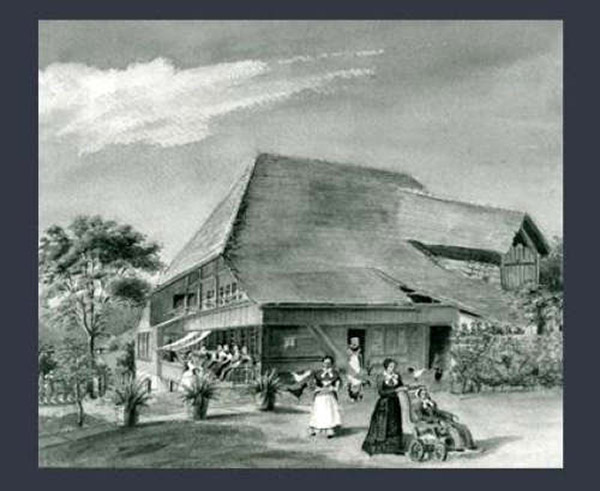Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man die übersinnliche Welt wahrnehmen kann? Frank Burdich, ehemaliger Waldorf-Lehrer, Anthroposoph und Buchautor, zeigt, dass jeder Mensch näher an dieser Fähigkeit ist, als er glaubt.
Frank Burdich bietet dieses Jahr zwei spannende Seminare im Rüttihubelbad an, in denen Sie Ihren eigenen Zugang zur übersinnlichen Wahrnehmung entdecken und vertiefen können:
📅 Einführungskurs: 16.–18. Mai 2025
📅 Vertiefungskurs: 3.– 6. Juli 2025
👉 Weitere Informationen zum Kurs finden Sie hier.
Lesen Sie hier das exklusive Interview mit Frank Burdich über seine persönliche Reise zur Anthroposophie, die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität sowie die Bedeutung der Selbstverwandlung. Wir wünschen spannende Lektüre!
«Das Wichtige ist die Selbstverwandlung»
Was ist der Unterschied zwischen einer sinnlichen und einer übersinnlichen Wahrnehmung? Wir fragten Frank Burdich, ehemaliger Waldorf-Lehrer, überzeugter Anthroposoph, Vortragsredner, spiritueller Berater und seit neustem auch Buchautor.
Interview: Alice Baumann
Lieber Herr Burdich, warum sollte ich Ihr Buch «Übersinnliche Wahrnehmung» kaufen? Was vermitteln Sie Ihrer Leserschaft?
Viele Menschen denken, die übersinnlichen Welten wären weit entfernt, und man könnte sie nicht erreichen. Ich zeige in meinem Buch, dass jeder Mensch viel näher an der Wahrnehmung von Übersinnlichem ist als er glaubt. Genau genommen kann jeder Mensch übersinnliche Qualitäten erleben! Doch vom Spüren einer Stimmung in einem Raum bis zum Sehen der Aura des Menschen ist es ein längerer Weg. Hier nehme ich die Leserschaft bei den nötigen Entwicklungsschritten an die Hand. Und wer gar nicht an das Übersinnliche glaubt, sollte dieses Buch erst recht lesen – ich glaube, ich kann meine Leserinnen und Leser leicht vom Gegenteil überzeugen!
Ihr Buch wie auch Ihr breites Wirken gründen auf der über 100jährigen Anthroposophie. Durch welches Schlüsselerlebnis fanden Sie zu dieser Lehre? Was hat Ihre Wahrnehmung der Welt verwandelt?
Als Chemie- und Biologiestudent habe ich nur an meine Moleküle geglaubt. Das war meine Welt! Aus Krankheitsgründen geriet ich dann an einen klassischen Homöopathen und musste ganz schnell einsehen, dass diese Therapieform ausserordentlich wirksam ist, obwohl die Medikamente kein einziges Molekül der auf dem Medikament bezeichneten Substanz enthalten. Da wurde mir sozusagen der Boden unten den weltanschaulichen Füssen weggezogen, und ich musste mich neu orientieren. So habe ich zur Anthroposophie gefunden, die mir mit dem Konzept des Übersinnlichen einen theoretischen Hintergrund – denn so etwas mag man als Naturwissenschaftler – zum Verständnis meiner Erlebnisse am Medikament und schliesslich meiner übersinnlichen Erlebnisse geben konnte.
Sie haben Chemie und Biologie studiert und versucht, damit die Welt zu erklären. Als Naturwissenschaftler haben Sie eine Weltanschauung akzeptiert, die Pädagogik, Heilpädagogik, Landwirtschaft, Kunst und Medizin vereint. Sind Spüren und Analysieren gleichwertig?
Anthroposophie ist eine Wissenschaft – das ist ein riesiger Vorteil gegenüber manch anderen esoterischen Konzepten. In der Wissenschaft geht es immer um das Anwenden einer Methodik, die zur Erkenntnis führt. Das ist in der Anthroposophie bezüglich der übersinnlichen Wahrnehmung ganz genauso. Mir ist es wichtig, dass man sich bezüglich der jeweilig verwendeten Methodik der übersinnlichen Wahrnehmung ganz bewusst sein kann und damit in der Anwendung – vereinfacht gesagt – reproduzierbare Ergebnisse erhält. Somit liefern die Resultate der übersinnlichen Wahrnehmung die andere exakte Seite der Realität, welche die naturwissenschaftliche Forschung beschreibt.
Dieses Jahr wird der 100. Todestag von Rudolf Steiner mit klassischen Konzerten, getanzten Aufführungen und gesprochenen Vorträgen zelebriert. Warum ist sein damaliges Wirken für seine Anhänger:innen immer noch sehr aktuell und wichtig?
Rudolf Steiner konnte aus der Wahrnehmung der übersinnlichen Welt heraus Rat geben, wie man Landwirtschaft, Pädagogik, Medizin usw. menschengemäss und gesundend gestalten kann. Seine Konzepte sind auch heute noch wirksam und aktuell, um eine zunehmend reine Orientierung am Materialismus zu überwinden. Wenn ich aus der Perspektive der übersinnlichen Wahrnehmung sprechen darf: Rudolf Steiner hat die Möglichkeit gegeben, die Mittel zu entwickeln, hinter die Kulissen der Vorgänge jedes Bereichs der heutigen Gesellschaft zu schauen. Heutzutage braucht man nicht mehr nur an Rudolf Steiners Angaben zu glauben – er hat uns gelehrt, vom Glauben zum Erfahren und zum Wissen zu kommen!
Ein grosser Teil Ihrer Kundschaft besteht aus Akademiker:innen, die mit einem ebenso scharfen Verstand gesegnet sind wie Sie. Was geschieht in Ihren Kursen und Beratungen, damit die Wahrnehmung von Übersinnlichem und das Leben von Spiritualität plötzlich real werden?
Ich kann das übersinnliche Wahrnehmen nicht lehren. Aber in meinen Kursen können die Menschen erleben, wie weit sie bereits selber Zugang zum Übersinnlichen haben. Darauf aufbauend gebe ich ihnen passende Methodiken zu Hand, so dass sie unabhängig von meinen Kursen in ihren eigenen Zusammenhängen wahrnehmen können. Und ich gebe – auch in meinen Beratungen – Hinweise, wie die Menschen üben können, sich weiterzuentwickeln und damit harmonischer auf ihre jeweilige Umgebung einwirken zu können und damit verbunden auch, um ihren Zugang zum Übersinnlichen zu vertiefen.
Gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, mit denen Sie Ihre Seminarteilnehmenden und Vortragsgäste überzeugen können? Oder leben Sie gut damit, dass viele Dinge weder materiell nachweisbar noch mit Worten erklärbar sind?
Rudolf Steiner hat mal gesagt, man könne auch einen Walfisch nicht beweisen. Es geht nicht um das Nachweisen, man kann das Übersinnliche nicht beweisen – man kann es erleben! Und dann wird es evident. Oder aber umgekehrt: Für viele Dinge, die wir im normalen täglichen Leben ein Evidenzerlebnis haben, gibt es keine naturwissenschaftliche Erklärung. Das beste Beispiel dafür ist das Leben selber. Man kann es nur in seinen Kriterien beschreiben: Reizbarkeit, Wachstum, Stoffwechsel, Bewegung usw. Doch was das Leben ist, weiss auch die Biologie nicht. Die übersinnliche Wissenschaft, die Geistesforschung, liefert hierzu Konzept und Erlebnis!
Sie lieben präzise Erklärungen, methodische Herleitungen und abstrakte Schemen. Inwiefern ist übersinnliche Wahrnehmung dadurch lehr- und lernbar? Wie machen Sie dem Publikum Ihre Überzeugung und Methodik zugänglich?
Das Schema lehrt die Wahrnehmung nicht. Aber wer sich zum Beispiel langsam einem Baum annähert, der wird Schritt für Schritt Erlebnisse in der Veränderung seiner Gestimmtheit und seines Lebensgefühls erleben. Macht man das in einer Gruppe, fügen sich die Wahrnehmungen der Teilnehmenden wie Puzzlestücke zusammen und bestätigen sich gegenseitig. So kommt man zu einer als evident erlebten Beschreibung der übersinnlichen Strukturen des Baums. Das Schema ist nicht der Anfang, sondern das Ergebnis!
Und wenn jemand zum Erlebnis des Übersinnlichen kommt – was jedem auf den Kursen gelingt, auch wenn die Person es nicht erwartet hat –, kann ich ihm eine Methodik geben. Damit lernt die Person die übersinnliche Wahrnehmung nicht – sie wird ihre Fähigkeiten aber erweitern und präzisieren können.
Sie reden und schreiben über Äther- und Astralspuren, Elementarwesen und Verstorbene, die in Ihren Seminaren sichtbar werden. Über welche Eigenschaften sollte Ihre Kundschaft verfügen, damit sie solche Phänomene sieht?
Das Sehen dieser Strukturen kann ich nicht erwarten, und sie werden in den Seminaren auch nicht sichtbar. Ich kann nicht den Schleier von der geistigen Welt wegreissen. Ich helfe den Menschen, sich so zu entwickeln, dass sie die Wesen im Lauf ihres Schulungswegs möglicherweise sehen können. Das kann niemand erzwingen. Aber jeder Mensch kann Verstorbene und Elementarwesen differenziert spüren! Das lasse ich die Menschen erfahren und damit können sie dann weiterüben. Wer Verstorbene und Elementarwesen ausmachen kann, hat es leichter, vom Spüren zum Sehen zu kommen.
Sie raten Ihrer Leser- und Zuhörerschaft, wie Sport treibende Menschen in einem Sportstadion Runde um Runde zu laufen und am Ende des Tages damit zufrieden zu sein, an keinem anderen Ziel als bei sich selbst anzukommen. Das ist ein sehr schönes Bild für die eigene Entwicklung. Wo stehen Sie selbst denn nach so vielen Jahren des geistigen «Trainings» mittlerweile?
Ich betreibe ein Unternehmen, das übersinnliche Wahrnehmung als Dienstleistung anbietet. Spirituelles «Aufräumen» von Häusern und Orten, Wirkung von technischen Geräten auf den Menschen, Wirkung von Therapieformen und Medikamenten – all das beobachte ich differenziert auf vielen übersinnlichen Ebenen. Ärztinnen und Ärzte im Bereich der Psychiatrie und der Onkologie arbeiten mit mir zusammen. Zu mir kommen viele Menschen, die wünschen, dass ich übersinnlich auf sie schaue, um die Blockaden zu finden, die sie nicht gesunden lassen. Mit der übersinnlichen Wahrnehmung arbeite ich also differenziert und lebenspraktisch. Runden im Stadion bin ich schon viele gelaufen, aber ich verstehe mich nach wie vor als Lernenden. Täglich erlebe ich, dass ich mein Wissen und meine Fähigkeiten erweitern kann – und so hoffe ich, dass sich mein eigener Schulungsweg fortsetzen kann, um den Menschen zu helfen, selber dem Geistigen näher zu kommen.
Welchen Gedanken möchten Sie unserer Leserschaft noch mitgeben?
Wir stehen auf dem Grund eines Ozeans von Übersinnlichem. Als Kinder konnten wir diese übersinnliche Welt noch alle wahrnehmen und haben es später verlernt. Ich möchte dazu ermuntern, sich der Welt zunächst wieder fühlend anzunähern. Hierbei die unterschiedlichen Qualitäten von Wesen zu erleben, ist bereits ein wichtiger Schritt, der motivieren mag, einen eigenen Schulungsweg aufzugreifen. Und der führt dazu, dass man harmonischer mit der Welt interagiert – mit der sichtbaren und der unsichtbaren. Das Wichtige ist die Selbstverwandlung, die sich dabei einstellt – das übersinnliche Schauen ein erfreuliches Nebenprodukt.
Danke für das Gespräch!