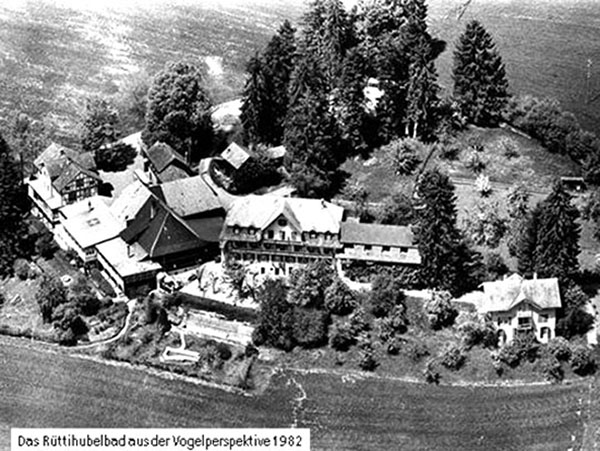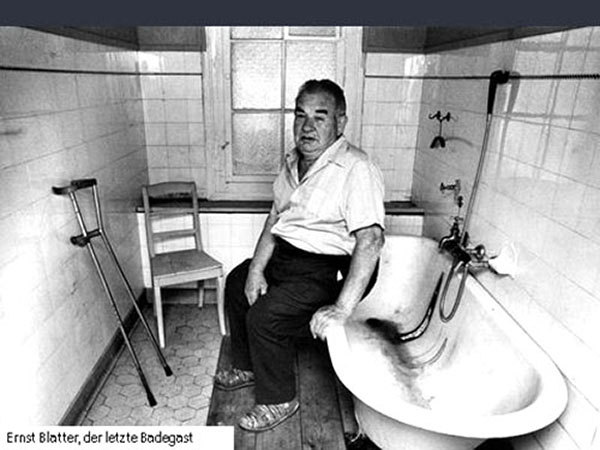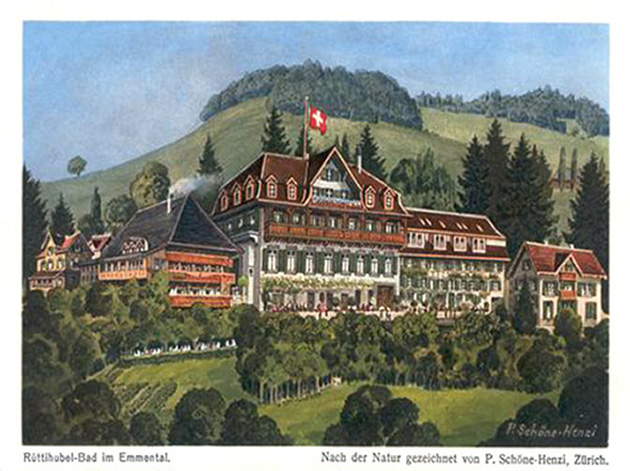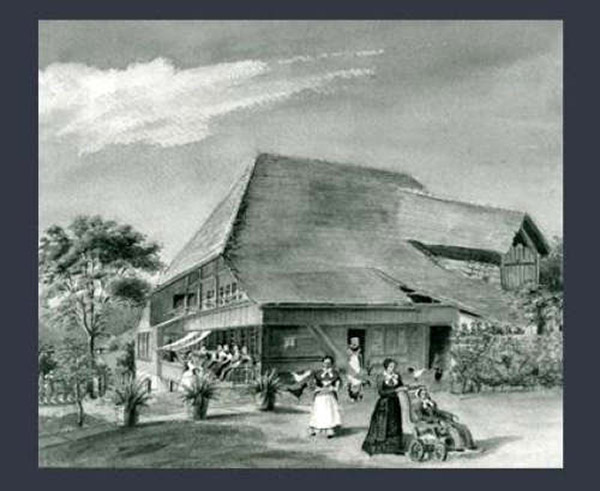Frequently Asked Question (FAQ)
Ist das Sensorium ein wissenschaftliches Zentrum?
Nein, denn das Sensorium soll keine wissenschaftlichen Phänomene erklären. Das Sensorium will, dass wir unserer Sinneswahrnehmung mehr Aufmerksamkeit schenken. Hier konzentrieren wir uns darauf, wie wir uns fühlen, wenn wir mit einer unserer 70 interaktiven Stationen experimentieren.
Ab welchem Alter können Kinder das Sensorium besuchen?
Eine Familie darf alle Kinder ins Sensorium mitnehmen. Auch wenn das Kleinste vielleicht noch nicht viel davon hat. Generell kann man sagen: ab sieben Jahren wird’s interessant. Wichtig ist, dass Eltern und Kinder immer zusammenbleiben und sich bewusst sind, dass sie sich in einem Museum befinden und nicht auf einem Robinsonspielplatz. Hier gelten die Werte: Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Langsamkeit.
Besucht man das Sensorium nur in einer Gruppe?
Keineswegs: Allein, mit Partner, in der Familie oder einer wie auch immer zusammengesetzten Gruppe: Schulklassen, Geburtstage, Firmen- oder Vereinsausflüge. Auch beliebt sind Führungen für Senior:innen.
Braucht es eine Führung und muss man diese im Voraus buchen?
Wie in jeder Ausstellung gilt: Man kann selber auf Entdeckungstour gehen oder man wählt ‚1. Klasse’ und lässt sich führen. Wenn Sie eine Führung wünschen, bitten wir sie, diese spätestens drei Tage im Voraus anzumelden, damit wir die für die Bedürfnisse Ihrer Gruppe geeignete Führungsperson auswählen können. Eine Führung dauert rund eine Stunde und hat zum Ziel, den Besuchern die verschiedenen Experimentierstationen näher zu bringen. Es ist aber während der Führung nicht möglich, dass alle Teilnehmenden ihre Erfahrungen gleich selber machen. Deshalb sollte man nach einer Führung mindestens eine Stunde zur freien Verfügung einkalkulieren.
Kann das Sensorium bei Schön- und Schlechtwetter besucht werden?
Ja. Bei schönem Wetter können Sie die lichtdurchfluteten Ausstellungsräume besuchen, die Stationen draussen entdecken und die schöne Aussicht geniessen. Vielleicht verbinden Sie den Museumsbesuch mit einer Velofahrt, einem Spaziergang oder einer Wanderung. Bei Schlechtwetter fahren Sie mit dem Postauto direkt vors Haus oder stellen Ihr Auto auf dem nahen Parkplatz ab.
Kann man das Sensorium auch zu Fuss erreichen?
Eine einstündige Wanderung führt Sie von Worb über den Worbberg direkt ins Rüttihubelbad. Vom Rüttihubelbad gelangen Sie in dreissig Minuten durch das Wikartswiler Moos zur Bahnstation Walkringen. Selbstverständlich auch in umgekehrter Richtung. Beachten Sie den Vorschlag der Berner Wanderwege in den Downloads.
Ist das Sensorium ein anthroposophisches Museum?
Seit 2004 ist das Sensorium in der anthroposophischen Stiftung Rüttihubelbad untergebracht, aber unser Museum hat keinen Bezug zur Anthroposophie. Die Philosophie des Sensoriums basiert auf den Ideen von Hugo Kükelhaus (1900-1984), der sagte: «Ich habe keine Weltanschauung, ich schaue die Welt an.»
Dürfen Hunde auch in die Ausstellung?
Ausser für Blindenführhunde ist der Eintritt für Hunde nicht gestattet. Sie können aber draussen oder im Vorraum angebunden werden.
Was kostet ein Besuch im Sensorium?
Die Preise finden Sie unter Öffnungszeiten und Preise. Die Eintrittspreise im Sensorium sind nicht subventioniert, wir müssen eigenwirtschaftlich arbeiten. Dennoch bemühen wir uns, die Preise so tief wie möglich zu halten.
Wie gelangt man zum Sensorium?
Hier klicken>> für Informationen zur Anfahrt und den Link zum Fahrplan der SBB (Postauto, etc.). Geben Sie Ihren Abgangsort ein und Rüttihubelbad als Zielort. So erhalten Sie die schnellste und zuverlässigste Information.
An wen richtet sich das Sensorium?
Grundsätzlich an jeden Menschen. Ob alt oder jung, alle Sinne werden hier angesprochen und zum bewussten Wahrnehmen angeregt. «Die Besucher:innen erfahren, wie das Auge sieht, das Ohr hört, die Nase riecht, die Haut fühlt, die Finger tasten, der Fuss versteht, die Hand begreift, das Gehirn denkt, die Lunge atmet, das Blut pulst und der Körper schwingt» (Hugo Kükelhaus).
Eignet sich das Sensorium für behinderte Menschen?
Selbstverständlich. Die Ausstellung ist rollstuhlgängig und hat z.B. mit der Rollstuhlschaukel ein spezielles Angebot nur für Behinderte. Die sensorischen Wahrnehmungen in dieser Ausstellung sind jedoch nicht alltäglich. Die Lichterscheinungen, Vibrationen und Tonphänomene können je nach Behinderung die Sinne auch überreizen.
Wie lange bracht man, um das Sensorium zu erleben?
Mindestens zwei Stunden. Viele bleiben auch einen halben Tag und länger bei uns. Aus diesem Grund sind unsere Eintritte Tageskarten (farbige Kleber). Damit sind Sie frei, so oft Sie wollen, hinein- und hinaus zu gehen. Besuchen Sie das gemütliche Restaurant oder das Selbstbedienungsrestaurant Lade-Kafi, machen Sie eine Wanderung oder einen Spaziergang, geniessen Sie den Alpenblick oder ein Picknick in der Umgebung und kommen Sie noch einmal ins Sensorium zurück.
Wie steht es mit der Verpflegung?
Picknicken im Sensorium ist ausdrücklich erlaubt. In der Picknick-Ecke können warme und kalte Getränke, Glace und hausgemachte Biscuits bezogen werden. Für ein gepflegtes Essen mit Messer und Gabel steht Ihnen das Restaurant im gleichen Gebäude zur Verfügung und das Lade-Kafi (Selbstbedienung) gleich nebenan. Reservieren Sie unbedingt ab 10 Personen. Weitere Informationen>>
Wie kann man sich auf einen Besuch vorbereiten?
Aus Erfahrung empfehlen wir Lehrerkräften und ihren Schüler:innen für den Besuch des Sensoriums kleine Aufgaben zu stellen. Zum Beispiel in kleinen Gruppen die Lieblingsstation finden und sie anschliessend im Plenum den Mitschüler:innen erklären. Der Besuch macht ruhiger sowie aufmerksamer und schenkt allen Gästen Freude. Für Anregungen und Unterstützung dürfen Sie sich jederzeit an unsere Ausstellungsbetreung wenden. Zusätzlich versucht Ihnen unsere Webseite bereits so viele Information wie möglich zu geben. Unter Downloads finden Sie eine Liste mit weiterführender Literatur, die Sie über Buchhandlungen beziehen oder in Bibliotheken finden können.
Wer war Hugo Kükelhaus?
Hugo Kükelhaus war ein universaler Denker, der auf zentrale Probleme unserer Zeit aufmerksam gemacht hat, aber auch Wege zu ihrer Überwindung wies. Er sah den Menschen der modernen, technischen Zivilisation gegenüber seinen leiblichen und seelischen Kräften verarmen und aus dem Lot geraten. Ursächlich hierfür erkannte er ein Wertesystem, das den Intellekt aus der Ganzheit der menschlichen Fähigkeiten einseitig heraushebt, sowie eine Technik und Umweltgestaltung, die auf eine Entlastung des Körpers und der Sinne statt auf deren Herausforderung angelegt ist.
Eine immer eintöniger werdende Umwelt, die den Sinnen nichts zu 'tun' übrig lässt und den grundlegenden körperlichen Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten immer weniger (Spiel)Raum gibt - Kükelhaus spricht geradezu von 'Lebensentzug' - korrespondierte in seinen Augen mit einer künstlichen Reizüberflutung, die durch die Überforderung bestimmter Sinne wie Sehen und Hören zum weiteren Abbau einer differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit beiträgt. Unermüdlich zeigte er die verheerenden Folgen für das menschliche Verhalten in allen Bezügen auf - zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zu Natur und Technik.
Die Wichtigkeit vielfältiger sinnlicher Erfahrungen - von Geburt an - unterstrich er bereits Ende der 30er Jahre durch die Entwicklung des Spielzeugs «Allbedeut», Holzspielzeuge zur Förderung der Sinne in den ersten Lebensjahren. Kükelhaus entwarf diese Spielzeuge unter dem Eindruck der Fröbelpädagogik und einer an Bedeutung gewinnenden Entwicklungspsychologie. Unter der Bezeichnung 'Greiflinge' erhielten sie später zahlreiche Auszeichnungen, und Kükelhaus wurde durch sie zum Wegbereiter heutiger Greifspielzeuge für Kleinstkinder.